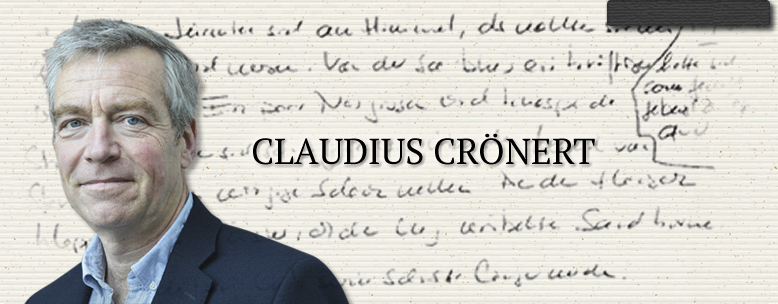Eins
Calais kam ihm wie eine Warnung vor. Als er mit seinem Begleiter aus dem Wald trat und die Küste endlich vor ihnen lag, sah er die dunkelgrauen Wolken, die sich über dem Meer auf- getürmt hatten. Einige bildeten eine Trichterform, fast wie ein Schlund, andere sahen wie Ungeheuer aus. Etwas Böses kündigte sich an, ein Zorn, der aus einer anderen Welt über sie hereinzubrechen drohte. Doch Henri war nicht bereit, auf die Zeichen zu hören. Zu sehr war sein Blick darauf gerichtet, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. An dessen Ende wartete eine Verheißung, und die lockte ihn, mehr als das, sie zog ihn mit aller Macht zu sich. Darüber vergaß er alles andere. Und so gingen sie in die Stadt hinein.
Calais war ein Fischerort mit einer lang gezogenen Hafenanlage. An den Molen schaukelten bunte Schiffe in feindseligen Wellen, die eigentlich von der Hafenmauer hätten abgehalten werden sollen. Auf einem der Kais redete ein Wanderprediger zu seinem Publikum, ein hagerer Mann in Mönchskutte, der sich auf einen Stab stützte, als wäre er Johannes der Täufer. In einem Handwagen war sein irdischer Besitz verstaut: ein Beutel aus Flachs, in dem ein Stück Brot stecken mochte, eine lederne Trinkflasche und eine Wolldecke. Es war offensichtlich, dass er im Wald übernachtet hatte, an Kutte und Haar hatte sich Laub verfangen.
»Kehrt um«, rief er mit durchdringender Stimme. Ein Dutzend Zuhörer, Männer wie Frauen, Alte und Junge, hatte einen Halbkreis um ihn gebildet. »Kehrt um, sage ich, solange ihr noch könnt. Das Himmelreich lässt sich nicht erlangen, wenn ihr irdischen Gelüsten nachrennt wie eine läufige Hündin. Deshalb fordere ich euch auf: Kehrt ab vom Laster.«
Ein paar Zuhörer senkten den Blick, die übrigen sahen zu, dass sie weiterkamen, und tauchten unter im Menschenstrom der Kais. Die Leute schleppten Säcke oder Kisten auf der Schulter oder zogen Schafe und Ziegen hinter sich her, die überall ihren Kot hinterließen. Sie wollten auf eines der Schiffe, die hier vertäut waren und die ostwärts Richtung Antwerpen und Amsterdam fuhren, um Frankreich herum gen Süden oder aber über den Kanal, der die Nordsee vom Ozean trennte und an dessen anderem Ufer die britannische Insel lag.
Auf der Rückseite der Kais standen einige Hütten. Die Männer, die dort ein und aus gingen, machten ernste Gesichter. Einer war ein großer Kerl mit dickem Bauch. Sein gelber Hut zeigte an, dass er der Hafenmeister war.
Die Reisenden, deren Schiffe erst später ausliefen, waren Beute der Händler, die überall kleine Stände aufgebaut hatten und Reiseproviant darboten, Wein, Brot und Käse, helles und dunkles Bier, kalte Hähnchenkeulen oder gesalzenen Fisch. Leichte Waren hatten sie mit Steinen gegen den Wind gesichert. Henri erkannte, wie geübt sie feilschten und wie bereitwillig sie niedrigere Gebote akzeptierten, weil ihr erster Preis viel zu hoch gewesen war. Er würde nicht auf sie hereinfallen. Die Stimme des Wanderpredigers hallte zu ihm hinüber. Er hatte sich einen Mann aus der Menge ausgeguckt. »Auch du, Bruder. Bedenke, wie heiß das Fegefeuer ist und wie wunderbar das Paradies. Du hast die Wahl, hast sie jeden Tag, den du auf Erden weilst. Kehr um, das rate ich dir. Nimm den Pfad, den der Allmächtige dir vorgibt. Es wird zu deinem Besten sein.«
Henri drehte sich um und sah, wie der Angesprochene die Augen niederschlug. Die Worte des Predigers hatten ihn erreicht und beugten ihn, es schien, als trüge er die Last einer begangenen Sünde auf seinen Schultern.
Mit sicherem Blick erfasste der Wanderprediger die Lage. »Beichte und tue Buße. Und dann lebe Verzicht. Einfachheit ist die Lehre, die Jesus Christus uns geschenkt hat. Einfachheit und Liebe.«
Henri ging weiter. Seit mehreren Tagen ließ er sich von einem englischen Mönch mit Namen Archibald führen. Auch Archibald trug eine Kutte, dennoch hätte der Unterschied zwischen ihm und dem Wanderprediger größer kaum sein können. Archibald war klein, hatte ein Bäuchlein, Tonsur, einen ordentlich gestutzten Bart, und seine hohe Stirn war voller heller Sommersprossen. Der Prediger hingegen war lang und dürr und sein Kopf- und Barthaar zerzaust. Obwohl auch Henri und Archibald gewandert waren und im Freien übernachtet hatten, sah die Kleidung des Mönchs sauber aus, und sein Gesicht war gewaschen.
»In Wahrheit«, sagte Archibald und zeigte auf den Wanderprediger, »setzt der Kerl darauf, dass ihm selbst seine Reden dereinst gutgeschrieben werden. Uneigennützig ist dieser Mensch ganz und gar nicht.«
Es war etwas an seinem Begleiter, das Henri nicht recht greifen konnte. Der Mann hatte einen strammen Schritt und schwieg die meiste Zeit. Doch dann begann er plötzlich zu reden, hatte seltsame Themen und dozierte ausführlich. Er sprach über die Lebensdauer von Bäumen, sogar über die von Steinen, stellte sie gegen die Flüchtigkeit der Wolken und wollte wissen, welche Art eine Seele hatte und welche nicht. Woran man das erkennen könne? Henri hatte nur selten über solche Probleme nachgedacht, deshalb blieb er meistens eine Antwort schuldig. Sein Eindruck war aber, dass der Mönch diese Fragen beim Gehen bedachte, und das beeindruckte ihn.
Sie kannten sich seit vier Tagen. Wie aus dem Nichts war dieser Archibald auf der Baustelle der Kathedrale in Reims aufgetaucht und hatte ihn angesprochen, in einer Mischung aus Englisch und Französisch: »Kennt Ihr Henri of Reims, den Baumeister?«
Henri zögerte. Er mochte nichts Falsches sagen. »Wer will das wissen?«
»Mein Name ist Archibald. Ich bin Mönch im Kloster von Harlesden in England und komme im Auftrag unseres Hofkaplans.« Sein Blick wanderte zu einer Papyrusrolle, die Henri unter dem Arm trug. »Seid Ihr der Baumeister Henri of Reims?«, fragte er.
Henri blinzelte gegen die Sonne. »Wenn ich es bin, was kann ich für Euch tun?«
»Dann werdet Ihr nach London gebeten. Genauer gesagt, nach Westminster.«
»Gebeten? Von wem?«
»Von unserem König.« Der Mönch zog ein Schriftstück aus seiner Tasche, auf dem ein rotes Siegel prangte. Er reichte es Henri.
»Aus welchem Grund würde der König mich zu sich bestellen?«
»Ihr sollt eine Kathedrale bauen, Sir. Die Abbey Westminster.«
Henris Verwirrung wurde nicht kleiner. »Eine Abtei?«
»Der Name ist ein wenig irreführend. Wir sind in unserem Land manchmal etwas altmodisch. Früher gab es ein Kloster mit einer Abtei. Aber nun soll dort eine Kathedrale entstehen – das ist der Wunsch des Königs.«
Henri beschloss, die Rede des Mönchs für einen Scherz zu halten. Auf den Baustellen gab es immer wieder Handwerker, die sich einiges einfallen ließen, um einen Kameraden zu verspotten. Sich dafür offenbar auch eine Kutte anzogen. Das Siegel jedenfalls war reichlich protzig und sicherlich gefälscht. Er rechnete damit, dass das Publikum des Witzbolds gleich hervorspringen und Henri auslachen würde.
Er schaute sich um. Da kam niemand.
Also erbrach er das Siegel und entfaltete den Brief. Die Schrift war klein und ausgesprochen regelmäßig, die Sprache Latein. Von einigen Pfarrern abgesehen kannte er niemanden, der Latein konnte, und er verstand das Schreiben nicht. Satz für Satz musste er sich vortasten und begann, jene Worte, die auf Französisch ähnlich klangen, zu übersetzen.
Mehrmals fragte er den Mönch nach Bedeutungen. Je mehr er entzifferte, desto stärker hielt er es für möglich, dass der Mönch die Wahrheit gesagt hatte, schon allein deshalb, weil sich kaum jemand die Mühe gemacht hätte, so viele Absätze in einer Sprache zu Papier zu bringen, die kaum jemand beherrschte. Handwerker konnten doch bestenfalls ihren Namen schreiben, und Henri selbst hatte das Lesen nur deshalb gelernt, weil sie während seiner Kindheit neben einer Kirche mit einem ehrgeizigen Pfarrer gelebt hatten.
Wenn er es richtig begriff, stand in dem Brief, dass Heinrich, von Gottes Gnaden König von England, ihn aufforderte, zu ihm zu kommen, sollte er bereit sein, eine weithin sichtbare Kirche im Ort Westminster bei London zu errichten. Genau das also, was der Mönch gesagt hatte.
Henri musterte den Mann, der da vor ihm stand und sich mit einem Taschentuch den Schweiß von der kahlen Stirn wischte. Konnte er ihm glauben? Trotz des Schriftstücks, das er in der Hand hielt, blieben ihm Zweifel. Kein normaler Mensch bekam einen Brief vom englischen König. Selbst wenn das Schreiben täuschend echt aussah, es konnte nur eine Fälschung sein.
Und gleichzeitig brach sich irgendwo in der Tiefe seines Kopfes ein anderer Gedanke Bahn, mehr ein Bild als eine Überlegung, und da erschien ihm dieser Brief wie eine Tür, die sich für einen kurzen Augenblick öffnete und die man nehmen oder verschmähen konnte. Die Verlockung, auch die letzten, hartnäckigen Erinnerungen an seine verlorene Familie hinter sich zu lassen, war stark. Blitzschnell traf Henri eine Entscheidung. Es zog ihn in die Ferne, er malte sie sich in hellen Farben aus. Das Versprechen auf einen Neubeginn.
Endlich ein Neubeginn.
Im Laufe der Jahre hatte er mit unzähligen englischen Handwerkern zusammengearbeitet, deshalb sprach er deren Sprache einigermaßen gut. Zur Wahrheit gehörte allerdings auch, dass er jeden anderen für eine solche Entscheidung verurteilt hätte. Man ließ nicht einfach stehen, woran man gerade arbeitete, doch genau das tat er nun. Er wusch sich Hände und Gesicht in einer Regentonne und verließ die Bau- stelle, ohne sich noch einmal umzudrehen. Archibald begleitete ihn zu seiner Unterkunft, wo er seine Sachen holte und natürlich die Pläne.
An einem Marktstand kauften sie Reiseproviant und verließen Reims durch das nördliche Stadttor. Nur einmal in seinem Leben hatte Henri eine ähnlich weitreichende Entscheidung getroffen, damals mit Gisèle. Das lag eine halbe Ewigkeit zurück.
Und nun war er in Calais, und der Himmel sah bedrohlich aus.
»Habt Ihr Angst vor dem Wasser?«, fragte Archibald.
Sie schlenderten immer noch über die Mole und betrachteten die Schiffe.
Henri, der noch nie aufs Meer hinausgefahren war, tat beiläufig. »Müsste ich?«
»Nun, manchmal bringen die Wellen ein Schiff ein wenig zum Schaukeln.«
Henri war kein Mann der See. Weitab von einer Küste geboren, konnte er nicht mal schwimmen – woher auch? –, und überhaupt war ihm das Meer nicht geheuer. Es kam ihm tief, unendlich groß, kalt und vor allem düster vor.
»Wenn es Euch recht ist, Baumeister, lasse ich Euch teilhaben am Leitsatz meines Lebens«, sagte der Mönch. »Er könnte Euch nützlich sein für den nächsten Abschnitt unserer Reise.«
»Bitte.«
»Er ist in einem einzigen Wort zusammenzufassen. Dieses Wort heißt: Vertrauen.« Der Mönch sah ihn mit großen Augen an. »Versteht Ihr?«
»Nein.«
»Wirklich nicht?« Nun breitete er auch noch die Hände aus, als empfinge er eine himmlische Botschaft. »Es ist ziemlich einfach. Wir müssen Gott vertrauen. Das erwartet Er von uns, und wenn wir uns von Ihm leiten lassen, ist Er bereit, uns zu führen.«
Henri zeigte nicht, dass er enttäuscht war. Dies war die Gedankenwelt eines Kirchenmannes, sie mochte für einen Mönch passen, der sein Leben hinter Klostermauern verbrachte und dort versorgt wurde. Ein Handwerker hingegen hatte sich auf andere Dinge zu verlassen, auf sorgfältig gezeichnete Pläne und feste Fundamente, auf Nachmessen und Probieren. Wenn man eine Kirchenwand von zwanzig Fuß Höhe bauen wollte, war Gottvertrauen ein bisschen wenig. Da musste man präzise arbeiten, andernfalls würde sie einstürzen.
Archibald blieb vor einem Schiff stehen. Es hatte nur einen Mast, um den das Segel gebunden war. Rund ums Deck lief eine Art Geländer, und rückseitig gab es ein paar Stufen, die in den Bauch des Schiffes führten und die alles andere als stabil aussahen.
»Ist das unser Schiff?«, fragte er den Mönch.
»Die Northumbria. Sie wird uns sicher und schnell nach England bringen. Ihr werdet sehen, die Reise ist kurz, je nach Windrichtung nicht mehr als ein paar Stunden. Da braucht man keine Sorgen zu haben.«
Der Himmel sprach eine andere Sprache. Die Wolken waren noch dunkler geworden, ballten sich nun tiefschwarz über der aufgebrachten See. An Land trieb der Wind Staub, Dreck und manchen tänzelnden Strohrest über die Kais. Ein Stückchen weiter, an den Hütten des Hafenmeisters und seiner Leute, klapperten die Fensterläden mit solcher Heftigkeit, als würde der Teufel selbst an ihnen rütteln.
Henri schluckte. Regen setzte ein, und er zog seinen Umhang über die Rolle mit den Plänen, die er sich mit einem Gürtel um den Bauch gebunden hatte. Von seiner zweiten Toga abgesehen waren diese Kopien alles, was er besaß. Der Nachweis seines Könnens, sein Eintritt in eine neue Welt.
Über einen Steg, an dessen Seite zwar ein Seil als Handlauf gespannt war, der aber trotzdem wackelig aussah, schleppten Matrosen Kisten an Bord. In der Mitte bog sich die Holzplanke unter dem Gewicht. Die Matrosen ließen sich davon nicht beirren. Sie gingen gebückt, immer zwei von ihnen trugen eine Kiste.
Als das Gepäck verladen war, gingen die ersten Passagiere an Bord. Unter ihnen war eine Frau, die mit unglaublicher Sicherheit über den schmalen Steg ging und das Halteseil verschmähte. Ihre Röcke waren lang, sie hielt sie auf der Seite ein wenig gerafft und schritt vorwärts. Der Gedanke, dass man bei einem unbedachten Tritt zwischen Schiffsbauch und Mole ins Meer fallen konnte, schien ihr nicht zu kommen.
»Es ist wie überall«, sagte Archibald neben ihm und rollte mit den Augen. »Zuerst die hohen Herrschaften. Diejenigen, die unter Deck Tisch und Stuhl bekommen.«
»Die Familie eines Grafen?«, fragte Henri.
»Die eines Barons«, verbesserte Archibald. »Der mit den weißen Haaren ist Humphrey of Farnham, ein recht bekannter Mann in meinem Land. Die jungen Leute vor ihm sind, wenn ich richtig sehe, sein Sohn und seine Tochter.«
»Und die anderen beiden?«
»Ein Diener und eine Zofe, nehme ich an.«
Henris Sorgen vor der Überfahrt wurden kleiner, als er der Baronsfamilie zusah. Er sagte sich, dass diese Leute kein Risiko eingehen würden.
»Also los«, nickte er Archibald zu.
»Das meine ich auch. England, geliebte Heimat, wir kommen. Mit Gottes Hilfe betreten wir am Nachmittag deinen Boden.«