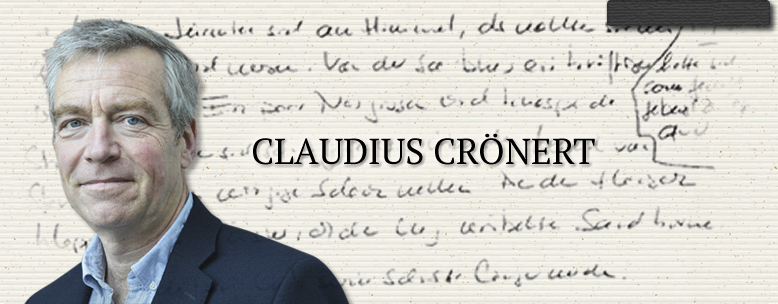1
Für Mila Kostelic gab es nichts Schöneres als einen freien Nachmittag. Keine Termine, keine Verpflichtungen. Man musste nicht in Form sein, weder geschminkt noch gut angezogen, man konnte sich nach Lust und Laune gehen lassen. In diesen Stunden hatte sie das Gefühl, innerlich weit zu werden. Freie Nachmittage waren ein Geschenk des Himmels.
Selbst das Bügeln hatte ihr Spaß gemacht, ohne den Druck, möglichst viel zu schaffen. Zunächst hatte sie sich ihre Blusen vorgenommen und dann Benjamins Polohemden, die sich am Kragen immer einrollten. Nun sahen sie wieder ordentlich aus, und die Kleidungsstücke, zusammengelegt und gestapelt, warteten darauf, in die Schränke geräumt zu werden.
Mila ließ sie liegen.
Sie hatte sich beigebracht, sich an einem freien Tag zu nichts, zu gar nichts zu zwingen. Stattdessen hatte sie sich auf dem Sofa ausgestreckt, die Beine angezogen und blätterte in einer Zeitschrift. Hier und da begann sie, die ersten Absätze eines Artikels zu lesen, über neue Scherereien am spanischen Hof und die Entwicklung der monegassischen Zwillinge, dann die Ernährungsvorschläge eines Südtiroler Naturheilers, der auf einem doppelseitigen Foto in einem Tal stand, hinter sich die schneefreien Berge, und der schon in der Überschrift behauptete, man müsse nur täglich Kräuter von heimischen Wiesen essen, dann würde man mühelos hundert Jahre alt werden.
Es klingelte.
Benjamin, der auf dem Fußboden über einem Puzzle saß, schaute auf. Mila fürchtete im ersten Moment, doch einen Termin vergessen zu haben. Aber das schloss sie aus. Wahrscheinlich war es nur ein Nachbar, der eine sperrige Sendung für sie angenommen hatte. Sie würde nicht öffnen.
Keine Störung, nicht an diesem Nachmittag.
Sie wandte sich den Modeseiten zu, Neues für den Herbst und Winter. Die Bilder waren groß, die Texte kurz. Benjamin war wieder in sein Puzzle versunken. Anders als sie besaß der Junge eine natürliche Ruhe und konnte alles um sich herum vergessen. In dieser Hinsicht hatte sie sich manches von ihm abgeschaut. Viel Ansprache brauchte er an Tagen wie diesem nicht, ihm reichte es, die Gegenwart seiner Mutter zu spüren. Davon allerdings schien er nie genug zu bekommen. Sie fragte sich, ob dieses Bedürfnis verschwinden würde, wenn er älter wäre und mit anderen Jugendlichen loszöge oder eine Freundin hätte.
Große Karos sollten bei Wintermänteln angesagt sein, bunte Farbtupfer im Allerlei von Schwarzgraubraun. Dazu lange Halstücher aus Seide, die den Ton der Karos aufnahmen. An den Models sah alles gefällig aus. Mila ging im Geiste ihre Garderobe durch, während sie dachte, dass sie neue Wintersachen nicht mehr in Berlin einkaufen würde. Zu der Zeit wäre sie bereits zurück in Ljubljana.
Es klingelte erneut. Fordernder diesmal, drängender.
Kein Nachbar, kein Päckchen.
Sie erwartete überhaupt keine Sendung.
Benjamin schaute sie an, die Frage auf den Lippen, ob sie nicht öffnen wolle. Nein, sie wollte nicht. Der Störenfried würde wieder verschwinden. Kein Mensch wusste, dass sie zu Hause war.
Der Ausschnitt des Puzzles, den Benjamin zusammengefügt hatte, war so groß, dass das Bild, eine Dorfszene, bereits in seinen Umrissen erkennbar war. Der Aufschrift nach war das Puzzle erst ab zwölf, dennoch würde er es mit seinen acht Jahren fertigstellen, daran hatte sie keinen Zweifel. Mochte es Tage dauern, sogar Wochen, er würde nicht aufgeben, würde sich morgens vor der Schule damit beschäftigen und erst recht in seiner freien Zeit am Nachmittag. Er liebte es, wenn diese Bilder mehr und mehr Form annahmen. Genügend Geduld für sie hatte er allemal.
Ein weiteres Klingeln. Lange diesmal, verbunden mit kräftigem Klopfen gegen ihre Tür.
Mila presste die Lippen aufeinander. Mit der Ruhe war es endgültig vorbei. Sie streckte die Beine auf dem Sofa aus, als wolle sie die Störung nicht wahrhaben. Zwang ihre Gedanken in eine andere Richtung. Es ging auf fünf, eine letzte Stunde noch, dann musste sie das Abendessen machen, und die Frage war, was sie im Haus hatte. Später, wenn Benjamin schlief, würde sie den Fernseher anschalten oder Filip anrufen und ihn fragen, wo er blieb. Ihr kleiner Bruder war der unzuverlässigste Mensch, den sie kannte, trotzdem – oder vielleicht gerade deswegen – liebte sie ihn über alles. Sie presste die Lippen aufeinander und griff nach einem Stift, um sich an das Kreuzworträtsel in der Zeitschrift zu machen. Der Schwierigkeitsgrad war so, dass sie nur darüber lächeln konnte, während sie den Namen einer europäischen Hauptstadt mit drei und die Bezeichnung für Koranverse mit vier Buchstaben eintrug.
An der Tür klingelte es nicht mehr.
Aber das Klopfen war heftiger als zuvor.
Sie ahnte, wer es war. Und er wusste, dass sie zu Hause war.
Leute wie er ließen sich nicht von verschlossenen Wohnungstüren abhalten. Und wenn der Kerl mit seinem verschlagenen Gesicht gleich in ihrem Zimmer stünde, bekäme ihr Sohn Angst wie noch nie in seinem Leben. Das musste sie verhindern.
Sie setzte darauf, dass es mit ein paar beschwichtigenden Worten getan sein würde.
„Benjamin, geh in dein Zimmer.“
„Mama, nein.“
Sie machte den Arm lang und streckte den Zeigefinger aus. „Tu, was ich dir sage.“
Der Junge versuchte keinen zweiten Widerspruch. Er stand auf und trottete davon. Sein gesenkter Kopf war das einzige Zeichen seines Unmuts.
Sie wartete, bis er die Tür hinter sich zugezogen hatte. In der Zwischenzeit warf sie einen Blick in den Spiegel. Sie trug Jeans und einen verwaschenen Baumwollpullover. Ihre Wangen, ohne jedes Rouge, waren blass. Das schwarze Haar, auf das die Männer so sehr reagierten, glänzte und wellte sich über ihren Schultern, die Augen waren schmal, ihre Nase war groß genug, um Respekt zu gebieten.
Ein neuerliches Klopfen. Nicht lauter als beim vorigen Mal. Aber auch nicht leiser.
Sie vergewisserte sich, dass Benjamins Tür wirklich geschlossen war, dann holte sie Luft und öffnete.
Nicht der, mit dem sie gerechnet hatte. Sondern sein Bruder.
Gegen alles, was sie empfand, setzte sie ein freundliches Lächeln auf. „Ich kann im Moment nicht.“
Der Mann an der Tür gab keine Antwort. Schaute sie nur an. Sein Gesicht war reglos.
„Nächste Woche, ja?“
Mit einer minimalen Bewegung schüttelte der Mann den Kopf.
„Was willst du?“
„Rate mal.“
„Kannst du mich nicht in Ruhe lassen. Ich habe doch gezahlt.“
Er stellte seine Fußspitze in die Tür. Er trug billige schwarze Schnürschuhe und war drauf und dran, sich Zutritt zu verschaffen. Sie wollte das nicht, deshalb streckte sie die Hand aus und drückte die Innenfläche gegen die Wand. Du darfst nicht herein, sollte das heißen. Noch während sie ihre Schranke aufbaute, war ihr klar, dass sie nicht viel nützte. Wenn er wollte, würde er sie durchbrechen. Dafür müsste er sich nicht einmal besonders anstrengen.
„Nur die Hälfte“, sagte er.
Das war seine Version. Die seines Bruders, vor allem die ihres Auftraggebers. Sie hatte eine andere. Allerdings war es sinnlos, mit diesem Mann, der nur Befehle ausführte, zu diskutieren. Sie versuchte es auf die weiche Tour.
„Ich habe euch gesagt, dass ich wegziehe.“
Er verdrehte die Augen. „Das ist bald sechs Wochen her.“
„Und?“
„Ganz einfach, Mila, der Chef glaubt dir nicht mehr. Er ist davon überzeugt, dass du fremdgehst.“
„Nein!“
„Dann leistest du am besten eine Nachzahlung. Auf diese Weise kann er sicher sein, dass du nicht an seine Feinde abdrückst.“
„Das tue ich nicht. Nach zwölf Jahren in Deutschland dauert es etwas, bis man alles zusammengepackt hat. Ich muss meinen ganzen Haushalt auflösen. Arbeiten tue ich fast gar nicht mehr.“
Er verzog den Mund zu einem dünnen, beinahe freundlichen Lächeln und wandte sich ab. Als sich bei ihr schon Erleichterung einstellen wollte, wirbelte er mit Schwung herum und wuchtete seine Schulter gegen die Tür. Mila hatte nicht den Hauch einer Chance. Das Ding sprang auf und schlug auf der anderen Seite gegen die Garderobenstange. Es war klar, dass Benjamin den Krach gehört hatte. Doch er würde sich nicht rühren. Er wusste, dass er das nicht durfte.
Sie schloss die Außentür und zeigte Richtung Wohnzimmer.
Als sie beide eingetreten waren, machte sie auch die Glastür zu. Sie war so sauer, dass sie die Fäuste ballte, und brauchte all ihre Selbstbeherrschung, um sich nichts anmerken zu lassen. Mit dem Kerl zu streiten würde zu nichts Gutem führen.
Er stand vor ihr, und sie dachte daran, ihn zu verführen. Er strahlte eine gewisse Einsamkeit aus, es war gut möglich, dass er mitspielte, und am Ende würde er ihr als männlicher Beschützer irgendeine Lösung vorschlagen. Doch mit Benjamin im Nebenzimmer kam dieser Ausweg nicht infrage.
Noch bevor sie ein Wort sagen konnte, traf sie seine Faust. Der Schlag erwischte sie am Oberbauch. Zusammen mit der Überraschung sorgte er dafür, dass sie sich krümmte und nach Luft schnappte. Ein zweiter Hieb, diesmal auf den Rücken, warf sie zu Boden. Sie japste. Sie wollte schreien, laut um Hilfe rufen und ihren Schmerz und ihre Wut herausbrüllen. Aber am Ende würde nur Benjamin sie hören. Es war jenseits ihrer Vorstellung, ihren Sohn in diese Angelegenheit hineinzuziehen.
Sie presste die Hand vor den Mund, während sie aufschluchzte. „Hör auf.“
Er erwischte sie erneut, diesmal mit der Fußspitze am Steißbein. Der Schmerz schoss die Wirbelsäule hinauf. In ihrem Kopf drehten sich blaugelbe Sternchen und sie fürchtete, das Bewusstsein zu verlieren. Mit letzter Willenskraft versuchte sie, ein Stückchen zu kriechen, um aus seiner Reichweite zu entkommen. Stille Tränen liefen ihr aus den Augen. Hätte sie nur diese blöde Tür nicht geöffnet. Oder, noch besser, wäre sie doch längst verschwunden. Mit Benny im Auto, auf dem Weg nach Hause.
Auf ihr Davonkriechen reagierte er, indem er seinen Schuhabsatz auf ihren Knöchel stellte und dann mit seinem Gewicht den Druck erhöhte. Sie glaubte, das Gelenk würde brechen, aber das tat es nicht. In der nächsten Sekunde war er schon wieder herunter. Zurück blieb neuer Schmerz, so heftig wie der davor.
Ehe sie ihn auch nur im Ansatz verarbeitet hatte, trat er noch einmal zu. Sie stöhnte auf. Dabei entfuhr ihr auch sein Name, aber die beiden Silben verschwammen in ihren Schmerzenslauten.
Reglos blieb sie liegen.
Sie war erfüllt von der Angst vor weiteren Tritten und Schlägen, doch der Mann tat ihr nicht weiter weh. Sie vermutete, dass er ihr eine Minute oder zwei einräumte, um sich zu sammeln und ihm ein konkreteres Angebot zu unterbreiten. Allerdings verweigerte ihr Verstand jedes Denken. Da war Schmerz, ein betäubender Schmerz. Sonst nichts.
Doch, da war noch etwas.
Ein Ausweg. Ein einziger, gefahrvoller.
Sie musste es geschickt anstellen.
Unter Mühen hob sie ihren Arm an. Sogar mit dem Kopf kam sie etwas hoch. Unterdrückte die Tränen und ihre Angst.
„Ich …“, brachte sie hervor. Die Anstrengung ließ ihren Bauch krampfen. Trotzdem wiederholte sie. „Ich …“
Er stand breitbeinig über ihr. Alles konnte er mit ihr machen, alles.
„Ich … gebe dir das … Geld.“
Er nickte. Seine Haltung zeigte, dass er eine andere Aussage nicht erwartet hatte.
„Nicht die ganze Summe, so viel habe ich nicht hier. Eine Anzahlung.“
Als er nicht reagierte, fügte sie hinzu: „Morgen den Rest.“
Ohne auf seine Zustimmung zu warten, kroch sie vorwärts, auf den Wandschrank zu. Sie kam sich vor wie ein Wurm. Mit jeder einzelnen Bewegung schossen vom Steiß her neue Wellen von Schmerz ihren Rücken herauf. Unvorstellbar, dass sie sich irgendwann wieder würde setzen können. So eine Scheiße, so ein Arschloch. Gegen ihre Angst blickte sie sich nicht um, sondern robbte vorwärts, wozu sie alle Kraft brauchte, die ihr geblieben war. Und bei jeder neuen Bewegung fürchtete sie, dass er wieder zutreten würde.
Sie hatte den Schrank fast erreicht.
„Darin versteckst du deine Kohle?“ Der Unglaube in seiner Stimme war nicht zu überhören.
„Nur das, was ich im Haus aufbewahre.“ Sie stöhnte, ihre Worte klangen gepresst. Darunter lag eine Mischung aus Schmerz und Übelkeit und Wut.
Sie hatte die Hand fast an der Schublade, musste sie nur noch aufziehen. Nun konnte sie dem Drang, den Scheißkerl anzusehen, nicht mehr widerstehen. Er war immer noch an seinem Platz, in einigem Abstand von ihr, die Beine so breit wie zuvor. Ein Cowboy, der in der falschen Epoche zur Welt gekommen war. Überlegen und cool.
Unter größter Anstrengung stützte sie sich auf die Knie. Ein weiterer Schub höllischer Schmerzen zog ihren Rücken hinauf. Sie verkrampfte. Auf der Stirn brach der Schweiß aus. Fuß und Knöchel fühlten sich taub an, während ihr die Nerven an ihrer Wirbelsäule nackt und wund vorkamen. Dennoch war es ausgeschlossen aufzugeben. Diesen Gedanken ließ sie nicht zu.
Stattdessen biss sie sich auf die Zähne, während sie die Schublade aufzog.
Für einen Moment kam ihr der Mann in den Sinn, der ihr die Waffe gegeben, ach was, aufgeschwatzt hatte. Man müsse immer damit rechnen, dass es böse Menschen gebe, hatte er gesagt, und in ihrem Beruf sei sie allzu oft mit Männern allein, denen es gefiele, Macht auszuüben. Er selbst, der ihr die Pistole geschenkt hatte, war nicht so, ganz und gar nicht, er war ein Gentleman, wahrscheinlich der einzige, den es in ihrem Leben gab. Sie hatte darüber geschmunzelt, als ausgerechnet er über das Böse fabulierte. Auch hatte sie den Einwand vorgebracht, dass sie nicht schießen könne.
Er hatte es ihr gezeigt, das Entsichern, das Zielen, den Abzug.
Nur abgedrückt hatte sie nicht.
Sie hoffte, es auch diesmal nicht tun zu müssen.
Ihr fiel ein, dass er ihr sogar den Markennamen der Waffe genannt hatte. Sie hatte ihn vergessen. Und jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt, in den verborgenen Winkeln ihres Gehirns danach zu suchen.
Hinter sich hörte sie Schritte. Der Angreifer kam näher, wahrscheinlich um zu sehen, wie viel Geld sie in ihrem Schrank hortete. Schnell griff sie nach der Pistole, unterdrückte ein neuerliches Zittern ihrer Gelenke, drehte sich um und richtete die Waffe auf ihn.
Er machte instinktiv ein paar Schritte nach hinten und spreizte die Finger vor der Brust, als würde ihn das schützen. Dabei grinste er blöd. Offenbar wollte er nicht akzeptieren, dass sich das Blatt gewendet hatte. Wahrscheinlich überlegte er, was er tun konnte.
Sie begann, sich mithilfe ihrer freien linken Hand auf die Füße zu ziehen. Es war mühsam, weil sie gegen den Schmerz in ihrem Rücken angehen musste. Doch auf Knien war es nicht möglich, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und endlich stand sie. Zitterte zwar, aber stand.
„Mach dich nicht lächerlich“, sagte er, während er gleichzeitig zwei weitere Schritte nach hinten setzte. „Das kleine Ding.“
Sie entsicherte, wie sie es gelernt hatte. „Kann dich töten.“
„So ein Quatsch.“
Anstelle einer Antwort riss sie ihren Arm höher und streckte ihn durch. Eine Geste, die ihn anhalten ließ. Immerhin.
Allerdings grinste er immer noch und sein Gesicht sah so selbstgefällig und abstoßend aus wie zuvor. „Selbst wenn du mich umlegst, gewinnst du nichts. Lebenslänglich hinter Gittern.“ Seine Hand kam nach vorne. „Gib das Ding her, dann vergessen wir diesen kleinen Zwischenfall.“
Sie ließ ihn nicht aus den Augen, während sie die Zimmertür öffnete und in den Flur hinausrief. „Benjamin, lauf zu Harriet. Los, sofort.“
Der Eindringling schien abwarten zu wollen, er rührte sich nicht. Schaute nur zu, wie sie hinter sich griff, dorthin tastete, wo ihre Handtasche lag.
Und dann stand plötzlich Benjamin im Flur und starrte sie mit offenem Mund an. Er musste sich schon vorher aus seinem Zimmer geschlichen haben. Jetzt sah er seine Mutter durch den Türspalt – und auch die Waffe in ihrer Hand.
Mila wünschte sich, unsichtbar zu sein.
„Mach schnell. Tu, was ich dir sage. Geh!“
Mit diesem Satz gab sie der Glastür einen Tritt, sodass sie mit einem Scheppern zufiel. Den Blick immerzu auf den Angreifer gerichtet, zog sie ihr Handy aus der Tasche und drückte eine Kurzwahltaste. Hörte zugleich das vertraute Geräusch, wie die Wohnungstür zugezogen wurde.
Ihr Junge war in Sicherheit.
Sie atmete aus. Der erste Teil war geschafft.
Er kam wieder näher. „Wenn du die Polizei rufst, hast du endgültig verloren. Dann werden wir dich jagen. Mit Verrätern gibt’s kein Erbarmen.“
Sie tat, als habe sie die Drohung überhört. Als sich am anderen Ende eine Frauenstimme meldete, sagte sie nur, Benjamin sei auf dem Weg zu ihr. Ob sie ihn in Empfang nehmen könne?
„Was ist denn los?“
„Bist du zu Hause?“
„Ja.“
„Dann ist gut. Bitte warte auf ihn.“
Mit einem neuerlichen Schmerzschub aus dem Steißbein wurde ihr linker Arm taub. Die Gefühllosigkeit ging hinunter bis in die Fingerspitzen. Ihre Hand mit dem Telefon darin zitterte. Sie ermahnte sich, es festzuhalten, und kämpfte einen kurzen inneren Kampf mit den unkontrollierbaren Reaktionen ihrer Nerven. Dann ließ sie es fallen. Und beging den Fehler, dem blöden Ding nachzublicken. Eine oder zwei Sekunden reichten. In diesem Moment sprang er vor und drückte ihr, bevor sie reagieren konnte, die rechte Hand mit der Waffe darin nach oben. Dann drehte er ihr den Arm mit aller Gewalt auf den Rücken. Sofort spürte sie ein Reißen und Stechen, neue Qualen, diesmal aus der Schulter. Sie hatte keine Möglichkeit, die Waffe festzuhalten, auch sie fiel und er schob sie mit dem Fuß zur Seite. Im nächsten Moment lag Mila selbst wieder auf dem Boden und erneut stand er über ihr. Trat ein weiteres Mal zu.
Sie zuckte zusammen. Aus ihrem Mund kam ein neuerliches Stöhnen, schon leiser und kraftloser. Eine innere Stimme rief ihr zu, dass sie auf den Angreifer einreden müsse, das sei ihre allerletzte Chance. Sie müsse ihm klarmachen, dass sie sich nur habe wehren wollen. Dass sie kein Geld im Haus habe, aber in seiner Begleitung zur Bank gehen könnte. Jetzt, sofort.
Doch diese Stimme war weit weg. Sie klang wie ein Ruf aus weiter Ferne. Wie ein Hall.
Zudem bezweifelte Mila, dass sie den Weg bis zur Bank schaffen würde. Sie konnte sich nicht mehr bewegen. Wahrscheinlich würde sie nicht einmal die Wohnungstür erreichen.
Und dann war es auf einmal nicht mehr nur der Schmerz, der sich in alle Ecken ihres Körpers ausgebreitet hatte, sondern auch ihr Stolz, der eine solche versöhnliche Rede nicht zuließ. Sie empfand Trotz, während sie dem Scheißkerl mit einer Kraft, von der sie nicht gewusst hatte, dass sie noch in ihr steckte, entgegenschleuderte, womit sie ihn zu treffen glaubte: „Stark gegen eine Frau. Aber ein Feigling, wenn er gegen einen Mann antreten muss. Schäm dich.“
Sie blickte ihm in die Augen und stützte sich sogar ein wenig auf. Spuckte aus. „Du Feigling.“
Dann war er auf ihr. Die Waffe berührte sie im Gesicht.
Das Metall war eiskalt.
2
Larissa Rewald war in einer Stimmung, in der sie meinte, die ganze Welt umarmen zu können. Sie glaubte, auf dem Bürgersteig zu schweben. Jeder, der ihr entgegenkam, musste ihr die Fröhlichkeit ansehen, davon war sie überzeugt, schließlich strahlte sie von einer Wange zur anderen. Die Botschaft, die sie vor wenigen Minuten erhalten hatte, war so unglaublich und derartig gut, dass sie immer wieder versucht war, laut zu lachen. Sie, mit dieser üblen Angst vorm Zahnarzt. Der bereits kalter Schweiß aus den Händen und der Stirn trat, sobald sie sich auf den Stuhl setzte. Die heftige Fluchtimpulse bekam, wenn die grelle Lampe anging. Die Schmerzen schon alleine deshalb hatte, weil sie sie erwartete. Und die sich schließlich, da sie nicht anders konnte, verspannte, bis ihr der Hals steif war und der Nacken wehtat.
„Alles in Ordnung. In einem Jahr sehen wir uns wieder“, hatte der große, schmale Mann im weißen Kittel gesagt, nachdem er alle ihre Zähne gründlich angesehen hatte.
Er lächelte sie an. Zum ersten Mal in all den Jahren, die sie herkam, sah sie etwas Freundliches in seinem Gesicht, nicht nur diese mitleidlose Sachlichkeit. Er nahm seine Brille ab und ließ ihren Sitz in die senkrechte Position fahren.
„Sehr schön“, sagte er.
Sie ging davon aus, dass er irgendetwas übersehen hatte. Nahm sich augenblicklich vor zu schweigen. Selbst wenn er einen Fehler gemacht hatte, sie würde sich verdrücken und ihre Erleichterung genießen.
„Danke“, sagte sie.
„Keine Ursache. Ich danke Ihnen.“
Sie hatte ihre Tasche genommen und war gegangen. Hatte die Praxis mit einem fröhlichen Gruß Richtung Tresen verlassen und war die Treppe hinuntergesprungen, immer zwei Stufen auf einmal. Mit jedem Hüpfer war ihr stärker ins Bewusstsein getreten, was für ein Wunder ihr gerade widerfahren war. Und dabei hatte sich ihr Nacken entspannt.
Es war nicht warm, aber frühlingshaft mild. Die Sonne stand schräg über ihr, es war später Nachmittag. Sie kam allein wegen des Zahnarztes hierher nach Friedenau und der Weg zwischen der Praxis und dem U-Bahnhof am Friedrich-Wilhelm-Platz stand in ihrer Vorstellung für Angst und Grausen. Aus diesem Grund kam es nicht infrage, zu einem Arzt in ihrer Gegend, in Britz, zu wechseln. Dort war sie zu Hause und die Straßen sollten sie nicht an Schmerzen erinnern.
Diesmal war alles anders. Sie genoss den Weg zur U-Bahn, würde nach Hause fahren und einen wunderbaren Abend haben, ohne Kühlpäckchen und Schmerzen, ohne Mühe beim Reden. Mit einer Nacht, in der sie durchschlief. Mit einem kommenden Tag voll guter Laune.
Sie blickte zur Straße, wo sich zwei laute Motorräder offenbar ein Rennen lieferten, als etwas gegen sie stieß. Der Aufprall traf sie an Beinen und Bauch. Ein Kind, das in sie hineingelaufen war. Sie schaute auf einen Kopf mit schwarzen Haaren. Das Kind blieb vor ihr stehen und hielt in seiner Bewegung inne, als begreife es nicht, was ihm widerfahren war. Es schwankte ein wenig. Sie fürchtete, dass es mit dem Gesicht gegen ihre Gürtelschnalle gestoßen war.
Sie ging in die Hocke und blickte in ein hübsches, weiches Gesicht. Anders als ihr Sohn Jonas, dem sie selbst die Haare schnitt, hatte dieser Junge eine Frisur von einem Fachmann. Sein Pony fiel über die Augenbrauen, aber nicht über die Augen, die Haarlänge war vollkommen gleichmäßig und auch der angedeutete Scheitel saß perfekt, er war ordentlich und gleichzeitig leger. Der Junge hatte dunkle Augen, sein Gesicht eine liebenswerte, etwas scheue Ausstrahlung. Die Lippen waren hell, der Mund schmal. Er trug einen blauen Pulli und darunter ein Hemd, dessen Kragen herausstand. Larissa schätzte ihn etwa zwei Jahre älter als Jonas, demnach wäre er acht.
Sie legte ihm die Hand auf die Schulter. „Ich fürchte, wir sind zusammengestoßen. Hast du dir wehgetan?“
Keine Antwort. Der Junge schien sie nicht gehört zu haben. Seine Lippen verloren all ihre Farbe.
„Sprichst du Deutsch?“
Wieder nichts. Er wurde noch blasser. Sie nahm seine Hand, die kalt war.
Leute gingen vorüber, zwei Alte mit Rollator, dann eine Gruppe Bauarbeiter mit der obligaten Bierflasche in der Hand. Ein Jugendlicher mit Ohrstöpseln und einem Rucksack auf der Schulter.
Aber niemand, der ein Kind suchte.
Auch Stirn und Wangen des Jungen verloren an Farbe. Gleichzeitig verzog sich sein Mund zu einem Lächeln, das unnatürlich aussah, wie verkrampft.
Larissa stellte sich auf. Unter den Geschäften in der Nähe gab es eine Eisdiele. Sie kannte sie seit Jahren, ohne dort je etwas gekauft zu haben, denn vor dem Zahnarzt wollte sie keinen Zucker an ihre Zähne lassen und hinterher stand ihr der Sinn nicht nach Süßem. Ein weiteres Mal überblickte sie den Bürgersteig, fand aber niemanden, der nach einem Jungen Ausschau hielt.
„Komm, ich kaufe dir ein Eis. Gleich da vorne. Danach geht’s dir wieder besser.“
Nach wie vor hatte sie seine kleine Hand in ihrer und als sie losschritt, ließ er sich ohne Widerstand führen. Erneut ging ihr Jonas durch den Kopf und sie fragte sich, ob ihr Sohn genauso willenlos mit Fremden mitgehen würde. Gleichzeitig versicherte sie sich ihrer besten Absichten. Sie wollte diesem Jungen nichts Böses. Sein Kreislauf war durch den Zusammenprall schwach geworden, mit ein bisschen Zucker würde der Kleine wieder zu sich kommen. Und die Eisdiele lag so günstig zur Straße, dass sie eine Person sehen würde, die nach ihrem Kind suchte.
Vor der Glastheke, hinter der die verschiedenen Eissorten in Metallbehältern aufgebaut waren, beugte sie sich zu ihm. Der Junge, so hübsch und gepflegt er war, wirkte seltsam. Er hatte sich hierherführen lassen, ohne auch nur eine Frage zu stellen. Das Eis schien ihn nicht zu interessieren. Er schaute darauf, aber seine Augen leuchteten nicht. Er zeigte auch nicht darauf.
„Was möchtest du?“
Larissa bekam keine Antwort. Es machte den Eindruck, als begriff er nicht, was sie ihm anbot. Oder er verstand tatsächlich kein Deutsch.
Die Verkäuferin, ein rotblondes Mädchen mit Piercing in der Nase, wartete. Sie war es offensichtlich gewohnt, dass Kinder lange brauchten, bis sie sich entschieden.
Doch dieser Junge war anders. Er tat sich nicht mit seiner Entscheidung schwer, sondern schaute kaum hin.
„Eine Waffel mit Vanille und Schokolade“, bestellte Larissa für ihn. Und da sie schon einmal dabei war, kaufte sie sich zur Feier des Tages auch ein Eis.
Vor dem Lokal gab es drei Tische mit Plastikstühlen daran. Nur zwei von ihnen waren besetzt. Larissa steuerte den dritten an und zog den Jungen mit sich. Hier würden sie seine Mutter oder seinen Vater nicht verpassen.
Doch in den fünfzehn Minuten, die sie dort saßen, ihr Eis verspeisten und warteten, sah sie niemanden, der ein Kind vermisste. Der Junge kam langsam wieder zu sich, in seine Wangen und Lippen kehrte Farbe zurück.
„Na, geht´s besser?“
Er schaute sie mit seinen dunklen Augen an.
„Wohnst du hier in der Nähe?“
Er streckte die Hand aus und zeigte nach rechts, in die Stubenrauchstraße.
„Dann bringe ich dich jetzt nach Hause. Wie heißt du?“
„Benny.“ Seine Aussprache war klar und deutlich. „Benjamin“, verbesserte er.
Larissa nannte ihren Namen.
Sie nahm ihn nun nicht mehr an die Hand. Zusammen gingen sie in die Richtung, in die er gezeigt hatte, und blieben schließlich vor einem Gründerzeithaus stehen. Die Haustür hatte ein Schnappschloss und ließ sich von außen öffnen. Larissa fragte, in welchem Stockwerk er wohne.
Er stellte zwei Finger auf.
Im Treppenhaus war es vollkommen ruhig. Niemand kam ihnen entgegen, aus den Wohnungen hörte man keine Geräusche. Ihre Schritte wurden von einem Kokosläufer gedämpft.
Im zweiten Stock fand sie die Wohnungstür angelehnt. Sie blieb stehen, streckte den Kopf vor, lauschte. Es war nichts zu hören.
Benjamin war neben ihr. „Hier?“, fragte sie.
Er nickte.
„Und ist jemand zu Hause? Weißt du das?“
Sein Blick wurde starr, die Augenlider flatterten. Larissa war sich sicher, dass er Angst hatte. Seine Reaktion und die angelehnte Wohnungstür ließen sie innehalten. Möglich, dass sie als Polizistin zu leicht mit üblen Dingen rechnete, dennoch war Vorsicht geboten, auch weil niemand nach dem Jungen gesucht hatte.
Sie strich ihm über die Haare. „Ich gehe alleine da rein. Du wartest hier. Hast du verstanden?“
Er nickte.
Sie zeigte auf die Treppe. „Setz dich da hin und rühr dich nicht, bis ich wiederkomme.“
Ihre Waffe hatte sie nicht dabei, die lag in ihrer Schreibtischschublade. Leise öffnete sie die Tür. Achtete angestrengt auf Geräusche.
Es war nichts zu hören. Das musste nicht bedeuten, dass niemand in der Wohnung war. Einbrecher pflegten lautlos zu arbeiten.
Nirgendwo brannte eine Lampe, trotzdem konnte sie ganz gut sehen. Ein schwacher Parfumgeruch lag in der Luft. Larissa orientierte sich. Von dem kleinen Flur gingen vier Türen ab. Ganz rechts war ein Zimmer. Daneben, mit niedrigerem Eingang, das Bad. Dann zwei weitere Zimmer, eins davon mit einer Milchglasscheibe in der Tür. Hinter der Scheibe gab es keine Schatten und auch keine Bewegungen, deshalb nahm sie sich zunächst einen anderen Raum vor, den ganz rechts. Vorsichtig drückte sie die Klinke nieder.
Das Kinderzimmer. Ein flaches Bett mit Tagesdecke darüber. Ein niedriger Schreibtisch mit Schulranzen auf dem Stuhl. Ein Regal mit Büchern und zwei gerahmten Fotos. Sportlerposter an der Wand. Auf dem Bett ein Stofftier.
Sie schaute auch hinter die Tür. Es war niemand in diesem Zimmer. Auf Zehenspitzen schlich sie weiter und öffnete die nächste Tür. Das Badezimmer, ein schlauchartiger Raum mit Wanne und Waschmaschine, war ebenfalls leer. Sie registrierte zwei Zahnbürsten, eine davon für einen Erwachsenen, eine für ein Kind. An einem Haken hingen mehrere Ketten, es gab Cremes und Schminke. Larissa ging weiter und kam in ein Schlafzimmer mit Doppelbett und Wandschrank. Auch dieser Raum war sehr aufgeräumt. Das Kissen, das zu Dekozwecken auf dem Bett stand, hatte sogar einen Knick in der Mitte.
Mittlerweile glaubte sie nicht mehr, dass sich jemand in der Wohnung befand. Was auch immer hier geschehen war und den Jungen veranlasst hatte fortzulaufen, war vorbei. Sie öffnete die letzte Tür, die vom Flur ausging, die mit der Milchglasscheibe. Nur langsam schob sie sie weiter auf. Ihr erster Blick fiel auf ein Sofa an der Wand. Daneben stand ein kleiner Tisch mit einer aufgeschlagenen Zeitschrift darauf.
Die Türschwelle knarrte, als sie eintrat. Larissa sah einen Körper auf dem Fußboden. Dunkle Haare, die sich ausgebreitet hatten, angewinkelte Beine, ausgestreckte Arme. Sie wusste sofort, die Frau war tot. Sie lag auf dem Rücken und sah aus, als schlafe sie, aber sie atmete nicht und ihre Hautfarbe war gelblich.
Die Frau war erschossen worden. Ihr Mund war zerfetzt, im Gesicht gab es Flecken von Blut, und Blut war auch in Streifen daran heruntergelaufen und hatte dunkelrote Spuren hinterlassen.
Larissa hielt sich die Hand vor den Mund.
Sie musste die Kollegen rufen.
„Mama?“ Benjamins Stimme zitterte.
Sie drehte sich um. Er stand neben der Tür. Hielt sich an Larissas Arm fest.
„Steh auf, Mama.“
Kurz entschlossen nahm sie den Jungen, hob ihn hoch und machte sich daran, ihn nach draußen zu tragen. Sobald er merkte, was sie vorhatte, begann er zu strampeln. „Lass mich runter. Lass mich runter!“
Sie hielt ihn fest.
Seine Beine bewegten sich immer wilder, seine Füße trafen sie am Schenkel. „Ich will mein Puzzle weitermachen!“
Sie hatte die Teile gesehen, das auf dem Fußboden ausgebreitet waren. Benjamin wand sich in ihren Armen. Sie presste ihn an sich und schleppte das Kind aus der Wohnung, wo sie es auf die Füße stellte. Benjamin wollte sich losmachen und wieder hineinstürmen. Sie hielt ihn fest. Er versuchte sich loszureißen, aber sie hatte damit gerechnet.
„Hör auf. Du kannst da nicht wieder hinein.“
Er glotzte sie an, verständnislos, wie sie fand. Immerhin hatte er seinen Widerstand eingestellt. Er stand einfach da, als warte er auf eine Erklärung für ihr Verhalten.
„Du musst hier draußen bleiben, Benjamin“, flüsterte sie.
Er sprach genauso leise. „Was ist mit Mama?“
Larissa setzte sich auf eine der Stufen, dabei zog sie den Jungen vorsichtig zu sich heran und legte die Arme um ihn. Sie senkte ihren Blick. „Deine Mama …“
Benjamin starrte sie an. Seine Augen waren zwei Kugeln, die aus ihren Höhlen gleiten wollten. „Was?“
Larissa nahm seine beiden Hände in ihre. „Sie ist tot. Es tut mir leid.“
Er legte die Stirn in Falten, als hätte sie erneut etwas Unverständliches gesagt. Sie glaubte mit ansehen zu können, wie er ihren Satz nur nach und nach aufnahm. Es dauerte lange.
Dann, als er endlich verstanden hatte, wich alle Kraft aus dem Jungen. Er ließ den Kopf sinken, die Wirbelsäule knickte ein, seine Knie wurden weich.
Sie drückte ihn auf die Stufe neben sich. Legte ihre Hand vorsichtig auf seine Schulter. Wollte ihn, um ihn zu trösten, ein wenig zu sich heranziehen. Aber er war nicht zu bewegen, er war schwer und steif, vollkommen steif. Dabei hatte er den Kopf in den Nacken gepresst. Seine Arme reichten nach unten, die Beine, mit durchgedrückten Knien, nach vorne, sodass seine Füße nicht mehr auf der Stufe standen.
Für einen kurzen Moment überkam Larissa eine seltsame Erinnerung, gerade lang genug, um sie wahrzunehmen. Auch sie hatte früher auf diese Weise reagiert, wenn es ernst geworden war. Genau wie der Junge hatte sie sich steif gemacht. Als könne man so den Stürmen besser trotzen.
Oder als seien sie dann nicht real.
Er schien weder die Energie noch den Willen für einen erneuten Versuch zu haben, in die Wohnung vorzudringen. Trotzdem behielt sie ihn im Auge und ließ ihn auch nicht los, während sie mit der anderen Hand ihr Handy aus der Tasche fischte und die 110 wählte. Als der Telefondienst abnahm, stellte sie sich mit ihrer Dienstbezeichnung vor und meldete die Tat. Sie werde vor Ort warten, erklärte sie.
Als Nächstes ließ sie sich von der Zentrale die Nummer des bezirklichen Jugendamtes geben. Sie wählte sie, legte aber wieder auf, als nach dem dritten Klingeln niemand abgehoben hatte. Eine Nacht in einem Heim würde dem Jungen den Rest geben.
Es dauerte rund zehn Minuten, bis sie den Wagen des Dauerdienstes vor der Tür halten hörte. Zusammen mit den beiden Kollegen trafen zwei Streifenbeamte ein, zu viert kamen sie die Treppe hinauf und blieben vor ihr stehen. Ein Trupp, der Hinweise wollte.
Larissa stellte sich auf, während der Junge die Polizisten überhaupt nicht wahrzunehmen schien. Mit einer knappen Schilderung informierte sie den Kollegen Stuwe, den sie flüchtig kannte, über die Geschehnisse. Dabei drückte sie ihm ihre Karte in die Hand. Wer von den Ermittlern Fragen an sie habe, könne sie anrufen.
Er zeigte auf den Jungen. „Und er?“
„Steht unter Schock. Ich nehme ihn erst mal mit.“
„Bist du sicher? Ich kann eine Betreuung für ihn rufen, einen Psychologen, der Dienst hat.“
„Habe ich schon versucht. Da ist keiner mehr. Die haben Feierabend.“
„Das kann doch nicht sein, da muss es doch einen Notdienst geben. Und du, was hast du mit ihm vor? Willst du ihn mit nach Hause nehmen?“
Sie gab keine Antwort.
„Das verstößt gegen die Vorschriften, fürchte ich.“
„Ja, wahrscheinlich.“ Sie zog die Schultern hoch. „Aber, wie gesagt, bei der zuständigen Stelle ist niemand mehr. Da kann ich doch nichts dafür.“
Sie verließ den Tatort und nahm Benjamin mit sich.
Eine gute halbe Stunde später bog sie in ihre Straße ein. Der Junge ging an ihrer Hand. Auf dem ganzen Weg hatte er kein einziges Wort gesprochen. In der U-Bahn hatte sie ihm Fragen gestellt, nach seinem Vater, nach Großeltern, Onkeln und Tanten. Eine Antwort hatte sie nicht bekommen. Er schien ihre Worte nicht gehört zu haben. Auf sie machte er den Eindruck, als sei er weit, weit weg. Sie ließ ihn. Hielt seine Hand in ihrer, aber fragte nicht weiter.
Es war Feierabendzeit. Autos parkten in den Einfahrten, Leute saßen auf ihren Terrassen hinter grünen Sträuchern, aßen und tranken und genossen den milden Abend. Es roch nach Gegrilltem. Die Obstbäume waren bereits verblüht. Die Luft war trocken und staubig. Larissa wollte Benjamin ihr Haus bereits aus der Ferne zeigen, ließ es aber sein, weil er ihre Worte ohnehin nicht aufnehmen würde. Gleichzeitig ließ er sich von ihr, der fremden Frau, mitziehen und begleitete sie willig, fast wie ein verlassenes Tierchen auf der Suche nach einem neuen Zuhause.
Jonas und Michael saßen am Tisch und aßen.
„Ich habe jemanden mitgebracht.“ Larissa zeigte auf den Jungen neben sich.
„Und wer ist das?“, fragte Michael.
„Er heißt Benjamin. Auf Benny hört er auch, glaube ich.“
„Wo hast du ihn aufgegabelt?“
„Wir hatten in Friedenau einen kleinen Zusammenstoß. Seitdem weicht er mir nicht mehr von der Seite.“
„Vielleicht hat er Hunger.“ Michael richtete das Wort an ihn. „Möchtest du etwas essen? Da ist ein Platz.“ Er zeigte auf einen Stuhl. „Du kannst dich setzen.“
Der Junge blieb stumm. Larissa half ihm auf den freien Stuhl und zeigte auf das Brot. Er war immer noch blass. Sie belegte ihm die angebotene Scheibe Brot, schnitt sie sogar in Häppchen und stellte sie vor ihn.
„Kannst du essen“, sagte Jonas zu ihm. Er nahm eins der Häppchen und schob es in seinen Mund. „Siehst du?“
Aber Benjamin machte keine Anstalten, etwas zu sich zu nehmen. Er schien die Aufforderung von Jonas nicht gehört zu haben, schaute keinen von ihnen an, zeigte keinerlei Neugier für die neue Umgebung. Nein, er wirkte abwesend, als säße nur sein Körper an ihrem Tisch, während sein Geist in irgendwelchen fernen Regionen schwebte. Larissa bezweifelte, dass er bereits realisiert hatte, was mit seiner Mutter geschehen war.
Und gleichzeitig hatte ihr Tod ihn tief getroffen.
„Willst du mit mir spielen?“, fragte Jonas ihn, als er aufgegessen hatte.
Der Junge reagierte wieder nicht. Jonas stellte sich neben ihn und nahm seine Hand. Er zeigte auf eine Ecke im Wohnzimmer, wo einige seiner Spielsachen ihren Platz im Regal hatten, vor allem Tiere, mit denen er seinen Bauernhof bevölkerte, und ein paar Autos. Jonas zog ihn mit sich, was der Junge geschehen ließ. Mehr als alles andere schien er seinen Willen verloren zu haben. Auf Jonas’ Aufforderung hin sank er neben dem Regal auf die Knie und musterte die fremden Spielsachen. Nichts davon fasste er an. Jonas dagegen nahm zwei Autos in die Hände und ließ sie fahren.
Larissa und Michael schauten ihnen zu.
Sie begann, leise davon zu erzählen, was passiert war.
„Und du kannst ihn so einfach mitnehmen?“
„Natürlich nicht. Es gibt Vorschriften für den Fall eines verwaisten Kindes. Ich habe sie gebrochen, kann mich aber damit herausreden, dass im Jugendamt niemand ans Telefon gegangen ist. Es schien mir das Beste zu sein. Hoffentlich macht der Kollege vom Dauerdienst keine große Sache daraus.“
Michael seufzte und trank von seinem Bier. Als er es abgestellt hatte, kratzte er sich den Bart.
Jonas verließ die Spielecke und kam zu ihnen an den Tisch. „Ich glaube, der Junge ist stumm.“
Larissa legte ihm die Hand auf die Schulter. „Vielleicht mag er nur im Moment nicht reden.“
„Und warum nicht? Ich rede doch auch mit ihm.“
„Ihm geht es nicht besonders gut, fürchte ich.“
„Spielen kann man jedenfalls nicht mit dem.“
„Wahrscheinlich müssen wir etwas Geduld haben.“
Als sie ihren Satz ausgesprochen hatte, legte Michael die Stirn in Falten. Sie hätte gerne gewusst, welchen Gedanken er für sich behielt. Es war aber mit den Kindern in der Nähe nicht der richtige Zeitpunkt, ihn zu fragen.
Sie wandte sich an Jonas. „Wäre es in Ordnung, wenn ich für ihn die Gästematratze in dein Zimmer lege?“
„Von mir aus. Aber nicht direkt neben meinem Bett, ja?“